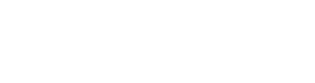Markenstrategie
Der Marke die richtige Kursrichtung geben
Eine Markenstrategie ist kein Luxus, sie ist vielmehr das Fundament.
Sie bildet die Grundlage für alle Entscheidungen, die Ihre Marke betreffen - heute und in Zukunft.
Wir entwickeln Ihren strategischen Kompass, der eine klare Richtung vorgibt.
Warum ist eine Markenstrategie wichtig?
Nur mit einem klaren strategischen Kompass kann das eigene Handeln zielgerichtet erfolgen, was sich letztlich in einer Erhöhung der Markenbekanntheit, der Bildung eines positiven Markenimages sowie dem Aufbau eines loyalen Kundenstamms widerspiegelt.
Was macht eine wirksame Markenstrategie aus?
Eine erfolgsversprechende Markenstrategie …
braucht eine glaubwürdige Unternehmensidentität als Fundament für klare Markenziele: Ohne Identität – keine Strategie.
sorgt für ein einheitliches Markenbild – intern wie extern
weist den Weg, um Ihre Markenbekanntheit gezielt zu steigern und ein positives Image zu formen
hilft, einen loyalen Kundenstamm aufzubauen und zu binden
Unser Vorgehen: Von der Analyse zur umsetzbaren Markenstrategie
Sie möchten Ihre Marke strategisch aufstellen – wir liefern den Fahrplan.
Unser strukturierter Prozess schafft Orientierung, Verbindlichkeit und Klarheit. Ziel ist eine Markenstrategie, die zur DNA Ihres Unternehmens passt – und zur Zukunft Ihrer Branche.
1. SWOT-ANALYSE: Klarheit schaffen mit Weitblick
Wir analysieren Ihr Unternehmen ganzheitlich – rückblickend, gegenwärtig und
zukunftsorientiert.
Vergangenheitsblick:
- Welche Werte, Haltungen und Kulturen prägen Ihre Marke historisch?
- Was sind Ihre „unternehmerischen Wurzeln“?
Gegenwartsanalyse:
- Produktportfolio & Kompetenzen aus Sicht Ihrer Zielgruppe
- Marktpositionierung im Wettbewerbsumfeld
- Kundensicht auf Kaufentscheidungen & Customer Journey
- Marktkräfte wie Lieferantenmacht, Substitution, Rückwärtsintegration
Zukunftsbetrachtung:
- Abgleich mit Ihrer Unternehmensstrategie
- Einflüsse von Megatrends und Marktveränderungen
2. HOUSE OF STRATEGY: Strategie formen
Basierend auf Ihrer unternehmerischen Identität entwickeln wir ein strategisches Gesamtkonzept – das House of Strategy. Dort verankern wir alle Bausteine Ihrer Markenstrategie systematisch. Es verbindet Identität, Ziele und Umsetzung in einem klaren strategischen Architekturplan:

- Vision: Wo wollen wir hin – ambitioniert, richtungsweisend, strategisch?
- Purpose: Wofür stehen wir – gesellschaftlich, sinnstiftend, über das Geschäft hinaus?
- Mission: Was treibt uns täglich an – und begeistert unsere Mitarbeitenden?
- Unternehmensziele: Welche übergreifenden, langfristigen Ziele verfolgt das Unternehmen?
- Strategische Ziele: Welche strategischen Fokusthemen werden zur Erreichung dieser Unternehmensziele herunter gebrochen?
- Strategische Handlungsfelder: Welche konkreten Maßnahmen dienen zur Umsetzung?
- Erfolgsvoraussetzungen: Welche Voraussetzungen sind zur Erreichung der Strategie elementar wichtig?
- Werte & Kultur: Welche Werte und Unternehmenskultur bilden das Fundament des Hauses?
Das Ergebnis:
Eine Markenstrategie, die Orientierung gibt, Entscheidungen vereinfacht – und Wirkung entfaltet. Im Familienbetrieb genauso wie im Technologiekonzern.
3. MARKENZIELE: Wirkung messbar machen
Im nächsten Schritt definieren wir strategische Markenziele in Bezug auf:
- Reputation & Markenimage
- Zielmärkte & Zielgruppen
- Produkt- und Preisstrategie
- Vertriebs- und Kommunikationswege
Daraus entsteht ein klarer Auftrag an das Markenmanagement – mit messbaren Zielen, Priorisierung und strategischer Relevanz für Ihre Wertschöpfung.
4. ROADMAP: Klarer Fahrplan zur Umsetzung
Zum Abschluss erhalten Sie eine konkrete Meilensteinplanung – mit Zeitrahmen, Verantwortlichkeiten und Budgetempfehlung. So wird aus Strategie konkretes Handeln mit Wirkung.
Ihr Nutzen aus unserer Markenstrategie
Mit unserem strukturierten Markenstrategie-Prozess erhalten Sie mehr als nur ein Konzept:
Sie gewinnen Orientierung und unternehmerische Schlagkraft
Strategische Klarheit
Unser Prozess schafft Transparenz über den Status quo Ihres Unternehmens
Verbindlicher Rahmen
Die Markenstrategie dient als verbindlicher Wegweiser für Marketing und Markenführung
Messbarer Markenerfolg
Wir definieren messbare Ziele und formulieren konkrete To Do’s zur Zielerreichung
Umsetzbarer Fahrplan
Die Festlegung von Budget, Verantwortlichen und Timing liefert eine verlässliche unternehmerische Perspektive, vereinfacht Entscheidungen und bringt Teams in Bewegung
Momentum
Motivation, Begeisterung und Aufbruchsstimmung im Unternehmen durch einen klaren Weg in die Zukunft
Stärkung von Marke & Marketing
Rolle des Marktings und Markenmanagement wandelt sich vom Kostentreiber zum aktiven Wachstumsmotor im Unternehmen
Warum Sie mit uns arbeiten sollten
Kontaktieren Sie mich!
Alexander Biesalski
MANAGING PARTNER
Weiteres zum Thema
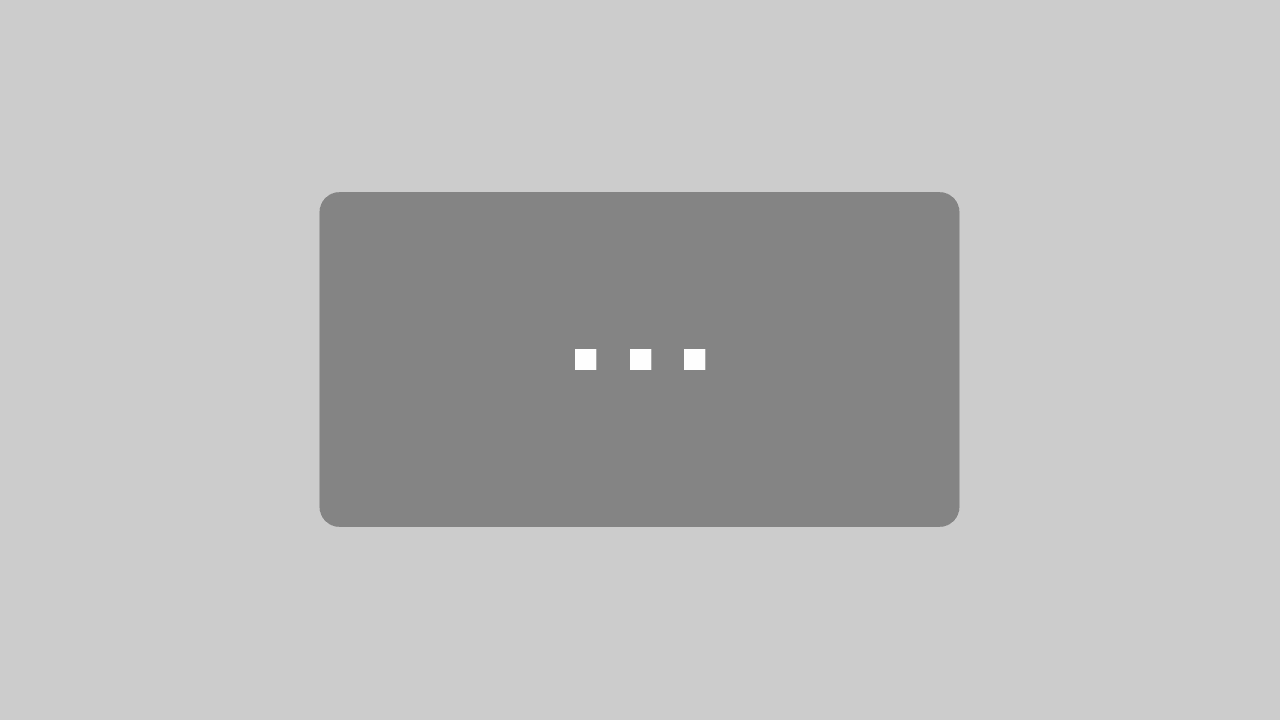
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Quellen & Lesetipps
- Pförtsch, W., Schmid, M. (2005). B2B – Markenmanagement. Konzepte-Methoden-Fallbeispiele. (1. Auflage). Vahlen. S.109-120.
- Esch, F.-R. (2007). Strategie und Technik der Markenführung. (4. Auflage). Vahlen. S.307-318.
- Baumgarth, C. (2018). B-to-B-Markenführung. Grundlagen-Konzepte-Best Practice. (2. Auflage). Springer. S. 319-328.